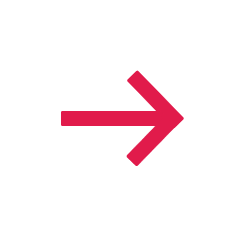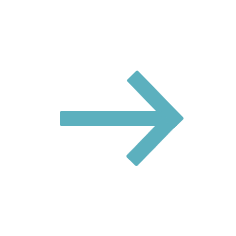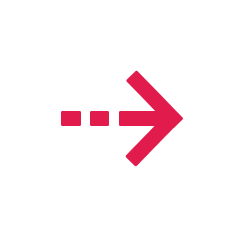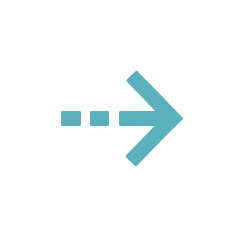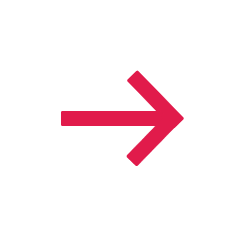
|
Trauer verarbeiten |
 Beachten
Beachten
- Reaktionen auf eine Todesnachricht können extrem unterschiedlich ausfallen:
- Von tiefer Bestürzung bis zum scheinbaren Unbeteiligt sein
- Jeder Mensch ist einzigartig und trauert darum auf seine ihm eigene Art und Weise
- Es gibt nicht „die“ Trauer und folglich auch nicht „die“ Trauerbegleitung
 Grundsätzlich
Grundsätzlich
Wie und mit welcher Intensität jemand einen Verlust verarbeitet, wird durch folgende Faktoren beeinflusst:
- Beziehungsintensität und -qualität zum Verstorbenen (z.B. liebevoll, belastet, konflikthaft)
- Alter und Entwicklungsstand (z.B. Vorstellungen vom Tod)
- Todesumstände (z.B. natürlicher, altersbedingter Tod, plötzlicher oder gewaltsamer Tod, Suizid)
- Familiäre Belastungsfaktoren (z.B. Suchterkrankung, materielle Not, zerrüttete familiäre Verhältnisse)
- Zurückliegende Erfahrungen mit Sterben, Tod und Trauer
- Bewältigungsmechanismen des Trauernden im Umgang mit Verlusten (z.B. förderliche oder hinderliche Strategien)
- Begleitung und Verständnis, die ein Trauernder in der Akutsituation sowie der Trauerzeit danach erfährt
- Das traumatisierende Ereignis setzt zwar den Arbeitsplan vorübergehend außer Kraft, ein möglichst geregelter Alltag mit Rechten und Pflichten vermittelt jedoch die Sicherheit, dass nicht alles zusammenbricht
- Häufig bemühen sich die Angehörigen möglichst rasch zur Tagesordnung überzugehen, weil ihnen dies Halt und Sicherheit in der Krise gibt
Dieses Verhalten kann auf Außenstehende so irritierend wirken, als ob in einer Familie nicht getrauert werden würde. Beides jedoch ist wichtig: Alltag und Trauer leben - familiärer Alltag sowie berufliche Verpflichtungen müssen bewältigt werden. Dazu gibt es hilfreiche Tipps.
- Trauer verläuft ganz individuell
- Dauer, Ausprägung und Intensität sind unterschiedlich und nicht vorhersehbar
- Je nach Situation sind einzelne Aufgaben der Trauerarbeit erst später möglich
- Werden sie über längere Zeit nicht erledigt, kann sich das auf die weitere Lebensgestaltung negativ auswirken
Um die Verschiedenartigkeit der Trauerbewältigung zu verstehen, gibt es verschiedene Modelle. Zwei davon werden hier vorgestellt:
Traueraufgaben nach J. William Worden:
Diese Betrachtungsweise der Traueraufgaben geht von einem aktiven Zugang zum Trauerprozess aus. Trauer ist dabei mehr als ein emotionaler Vorgang, darum ist auch Unterstützung von außen möglich. So kann es hilfreich sein, über den Krisenstab, die Polizei oder über die Notfallseelsorge eine Konfrontation mit dem Verstorbenen zu organisieren, damit ein Begreifen des Todes und eine Verabschiedung vom Verstorbenen (Aufgabe 1) überhaupt möglich ist. Mit den Traueraufgaben wird dem Trauernden auch eine aktive gedankliche Auseinandersetzung zugemutet. Dadurch verringert sich auf verschiedenen Ebenen das schwächende Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins.
Aufgabe 1:
Die Wirklichkeit des Verlustes verstandes- und gefühlsmäßig annehmen. Es ist wichtig für alle weiteren Schritte, den Tod des geliebten Menschen als Realität anzunehmen und das Geschehen zu begreifen. Manche Menschen bleiben in der Phase des Nichtwahrhabenwollens stecken, entweder durch ein Schutzgefühl der Betäubung oder durch hartnäckiges Leugnen über einen langen Zeitraum, dass der Tote wirklich tot ist. Es fällt schwer, sich den Verlust einzugestehen. Als Beispiel sei hier die Schwierigkeit genannt, den Tod zu akzeptieren, wenn der Leichnam fehlt und keine Hoffnung auf eine erfolgreiche Suche besteht. Dann ist es sinnvoll, diesen Schritt der Trauerarbeit durch eine Symbolhandlung zeichenhaft abzuschließen, um danach einen nächsten Schritt zu tun.
Aufgabe 2:
Die Schmerzen der Trauer durchleben Trauerarbeit geht nicht ohne eine Vielzahl von Gefühlen wie Schmerz, Wut, Ablehnung, Erleichterung. Das Durchhalten und Durchleben aller teils gegensätzlicher Gefühle hilft, den Verlust zu verarbeiten. Es ist wichtig, diese Gefühle weder zu bagatellisieren noch wegzutrösten. Gut gemeinte Ratschläge von Freunden, Kollegen, Verwandten führen dazu, den Trauernden aufzumuntern oder Trauer als ungesund oder übertrieben zu werten. Diese Fahrlässigkeit entspringt oft der eigenen Unfähigkeit, Trauer zuzulassen.
Aufgabe 3:
Sich an die eigene Umgebung anpassen, in der die verstorbene Person fehlt Dieser Schritt ist für die Bewältigung der Trauer nötig und schwierig. Denn damit geht es um spür- oder sichtbare Veränderungsprozesse. Neue Rollen müssen ausgefüllt werden, wenn zum Beispiel ein Ehepartner den Verstorbenen im Haushalt ersetzen oder er entsprechende Hilfe organisieren muss. Die eigenen Lebensziele müssen neu definiert werden, weil plötzlich das verstorbene Kind die eigene Lebensträume nicht ausleben wird. Die veränderten Anforderungen und Pflichten des täglichen Lebens stellen Trauernde oft vor unüberwindbar scheinende Hürden.
Aufgabe 4:
Der verstorbenen Person einen neuen Platz zuweisen und sich dem eigenen Leben zuwenden. Der Verstorbene wird nicht vergessen, sondern hin und wieder sehr aktiv in Erinnerung gerufen. In der übrigen Zeit wird das eigene Leben bewusst ohne ihn gestaltet. Es ist wichtig, dass der Verstorbene im veränderten Leben einen neuen Platz erhält. Der Trauernde muss einsehen, dass zwar nichts mehr ohne den geliebten Menschen je so sein wird, wie es einst war, aber dass das Leben neue Chancen bietet, neue Aspekte und dass das Sich-Öffnen für ein neues Leben nicht heißt, damit das Vergangene zu entwürdigen.
Trauerphasen nach Verena Kast:
Ihr sogenanntes Phasen-Modell lehnt sich den Sterbephasen nach Elisabeth Kübler-Ross an. Die dabei beschriebenen Merkmale ermöglichen es festzustellen, wo sich die Person im Trauerprozess befindet. Für jede Phase gibt es typische Gefühle, Äußerungen und körperliche und seelische Reaktionen.
Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens:
Gefühle sind Leere, Hohlheit, Empfindungslosigkeit, Chaos, Starre, Betäubung. Äußerungen sind «Das ist nicht möglich! Es kann nicht wahr sein! Ich glaube es nicht!». Körperliche und seelische Reaktionen sind Schock, Herzrasen, Unruhe, Sprachlosigkeit, Verwirrung, auch Funktionieren
Phase der aufbrechenden Emotionen:
Gefühle sind Wut, Ohnmacht, Zorn, Traurigkeit, Freude, Angst, Schuldgefühl. Äußerungen sind: «Wie konnte er mir das antun? Warum hat er mich zurückgelassen? Die Ärzte sind schuld! Wäre ich nur nicht weggefahren!». Körperliche und seelische Reaktionen sind Reizbarkeit, Depressionen, Desinteresse, Panikattacken, Atemnot, Schlaf- und Essstörungen, anklagen und idealisieren
Phase des Suchen und sich Trennens:
Gefühle sind Einsamkeit, Verzweiflung, Hilflosigkeit. Äußerungen sind „Ich habe sie/ihn gesehen. Nachts war sie/er da. Ich suche sie/ihn überall. Ich träume oft von ihr/ihm. Wie lange muss ich noch leben?“. Körperliche und seelische Reaktionen sind depressive Zustände, Suizidgedanken, Realitätsverlust, lautes Reden oder innere Zwiegespräche mit dem Verstorbenen, Überaktivität /Apathie
Phase des neuen Selbst- und Weltbezuges:
Gefühle sind Freude, Selbstachtung, Sinn, Befreiung, Ruhe, Dankbarkeit. Äußerungen «Ich kann Neues wagen. Ich bin stolz, was ich geschafft habe. Mein Leben hat wieder Sinn! Er/sie ist mein innerer Begleiter.». Körperliche und seelische Reaktionen sind Normalisierung der Köperreaktionen, Normalisierung im Alltagsrhythmus, Anfälligkeit für Rückfälle, labile Phasen, Überreaktion bei neueren Verlusten
Sowohl die Traueraufgaben wie die Trauerphasen sind nicht als chronologische und abgeschlossene Abfolge zu sehen. Vielmehr geht es darum, dass alle Aufgaben oder Phasen durchlebt werden sollten, in Teilbereichen, in Etappen, um überhaupt die eigene Vergänglichkeit annehmen zu können und um dem Weiterleben eine neue Lebensqualität zu ermöglichen. Die Aufgaben und Phasen sind also fließend in der gegenseitigen Abgrenzung, können wiederkehren und sich miteinander vermischen.